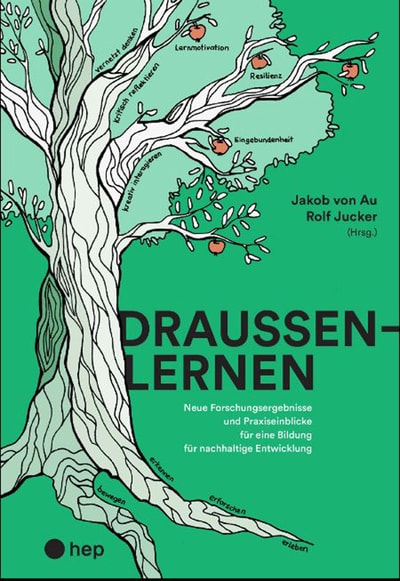Wenn der Lernort zum Lerninhalt wird
NewsBei steigenden Temperaturen profitieren alle von einem Ortswechsel. Im Interview spricht Nicole Schwery über das Draussenlernen, das sich nicht auf einen bestimmten Ort reduzieren lässt. Im Basler Stadtkanton ist ein Pausenhof genauso geeignet dafür wie der Wald.

Zur Person
Nicole Schwery ist Dozentin im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) an der Pädagogischen Hochschule Thurgau und geht als Leiterin der Spezialisierung «Naturpädagogik» mit den Studierenden jede Woche nach draussen. Seit über zwanzig Jahren arbeitet sie in der Natur- und Umweltbildung und ist Hauptkursleiterin beim CAS Naturbezogene Umweltbildung der Stiftung SILVIVA .
Basler Schulblatt: In den Schulzimmern wird es wärmer. Warum bietet sich ein Ortswechsel aus dem Schulraum an?
Nicole Schwery: Der Frühling und auch der Frühsommer bieten ideale Voraussetzungen, um mit dem Draussenlernen zu starten. Es bestehen so viele Lernmöglichkeiten mit allen Veränderungen, die in der Natur stattfinden, von Flora über Fauna – die ganze Vielfalt. Zudem sind die Temperaturen angenehm. Man kann jedoch zu jeder Jahreszeit rausgehen, da die Vorteile von Draussenlernen nicht saisonabhängig sind.
Was sind denn die Vorteile von Draussenlernen?
Wenn ich von den Vorteilen spreche, beziehe ich mich auf den Band «Draussenlernen» von Rolf Jucker und Jakob von Au, der aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirkung von regelmässigem Draussenlernen zusammenfasst. Naheliegend ist, dass sich Lehrpersonen und Kinder beim Draussenlernen mehr bewegen, dies fördert die Gesundheit. Auch die Grob- und Feinmotorik profitieren, da andere Bewegungsstrukturen angesprochen sind als im Schulzimmer. Man hat festgestellt, dass es draussen zu mehr Gesprächsmomenten zwischen den Kindern und mit der Lehrperson kommt. Damit ist das Draussenlernen beziehungsfördernd – was sehr zentral ist, da die Beziehung grundlegend ist fürs Lernen. Weiter verbessert der Unterricht draussen die Sprachförderung: So kann im Freispiel ein Stock für das erste Kind vielleicht ein Zauberstab sein, für ein nächstes eine Waffe und für ein drittes ein Werkzeug. Das Kind muss erklären, was es meint. Dadurch entstehen viele Sprachmomente. Auch haben Studien gezeigt, dass Kinder in einer Unterrichtsstunde im Freien konzentrierter sind. Dieser Zustand hält auch in der nächsten Stunde im Klassenzimmer an. Zudem verringert der Kontakt mit einer erholsamen Aussenumgebung die Symptome von Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen.
Ist Unterrichten ausserhalb des Klassenzimmers nicht eher stressig, wenn man es nicht gewohnt ist?
Ja, gerade zu Beginn ist für die Klasse und die Lehrperson vieles neu, anders. Das kann stressig sein. Es braucht Regelmässigkeit, damit sich alle am neuen Lernort sicher fühlen – ob im Wald oder auf dem Pausenhof. Zunächst muss eine Umgewöhnung stattfinden. Neu bedeutet immer auch Unruhe, und wenn die Klasse unruhig ist, dann wird es anstrengend. Aber das legt sich mit der Zeit. Es braucht Durchhaltewillen. Aber die Kinder profitieren enorm davon – und dann auch die Lehrpersonen. So viel zu den schulischen Vorteilen, aber es gibt auch Vorteile, wenn man den Blick in die Zukunft richtet.
Was meinen Sie damit?
Wenn wir auf die 4K-Kompetenzen blicken, die für das Lernen im 21. Jahrhundert entscheidend sind: Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und Kritisches Denken – stellen wir fest, dass Draussenlernen Kommunikation, Kreativität und Kollaboration fördert. Für Kollaboration bietet der Wald unzählige Beispiele, da vieles nur gemeinsam gelingt: Wer einen grossen Ast tragen möchte, muss zu zweit oder dritt sein. Zudem wird der Umgang mit Unvorhersehbarem gestärkt, weil man draussen flexibel bleiben muss. Immer wieder stösst man auf Momente, mit denen man nicht gerechnet hat: Das kann ein Wetterumschwung sein oder ein Fundstück. Somit kann das Draussenlernen auch einen Beitrag leisten, die Kompetenzen für das 21. Jahrhundert zu fördern.
Der Begriff «Draussenlernen» ist jetzt mehrfach gefallen: Was versteht man darunter?
Wenn Draussenlernen in Verbindung mit einer Klasse benutzt wird, die nach draussen geht, entsteht bei vielen Menschen schnell das Bild vom Wald. Und natürlich ist der Wald auch ein unglaublich toller Lernort, weil er eine ruhige Atmosphäre ausstrahlt, viele Strukturen und Materialien beinhaltet und sich im Verlauf des Jahres immer wieder verändert. Zudem ist er dreidimensional und vermittelt ein Raumgefühl, in dem man sich geborgen fühlen kann. Der Wald ist also der Prototyp von Draussenlernen, aber bei Weitem nicht der einzige Ort.
Im Stadtkanon Basel-Stadt kann das also auch ein Parkplatz sein?
Ja, Draussenlernen bezeichnet Unterricht ausserhalb des Schulzimmers oder des Schulhauses und kann überall stattfinden, wo die Lernumgebung für Kinder sicher ist. Die kann ganz naheliegend der Pausenplatz sein, aber auch eine Baustelle, der Bahnhof oder eine Parkanlage. Alle genannten Vorteile beziehen sich auf das Draussenlernen an sich und nicht auf einen spezifischen Lernort.
Welches ist der ideale Lernort?
Bei der Planung des Unterrichts – unabhängig vom Fach – überlegt man sich immer: Welche Ziele möchte ich mit der Klasse erreichen? An welchen Kompetenzen möchte ich arbeiten? Und mit welchen Inhalten erreiche ich diese Ziele? Ich versuche, bei meinen Studierenden einen Paradigmenwechsel einzuleiten, indem ich sie dazu auffordere, bei der Unterrichtsplanung immer auch die Frage nach dem geeigneten Lernort mitzudenken. Das kann das Schulzimmer sein, denn ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es draussen grundsätzlich besser ist. Mir geht es darum, die Frage immer mitzunehmen: Welcher Ort ist ideal für die Inhalte, die ich vermitteln will? Vielleicht ist es das Treppenhaus, weil sich dort Gegenstände im freien Fall besonders gut beobachten und erforschen lassen. Vielleicht ist es der Pausenplatz, weil wir dort mit Kreide sehr gut grosse geometrische Figuren zeichnen oder Distanzen berechnen können. Ein Lernort ist dann ideal, wenn er in die Überlegungen der Unterrichtsplanung miteinbezogen wird.
Also ein Ortswechsel im Sinne einer Unterrichtserweiterung?
Ich verstehe den Ortswechsel als wertvolle Ergänzung, von der man schnell merkt, wie viele Vorteile sie mit sich bringt. Warum diese Vorteile also nicht nutzen? Daher stehen für mich am Anfang das gedankliche Ausbrechen und die Frage: Wo halte ich heute meinen Unterricht ab? Ich werde oft gefragt: warum raus aus dem Schulzimmer? In diesem Zusammenhang stelle ich gerne die neckische Frage zurück: warum drinnen? Es ist eine Frage der Perspektive. Gehen Schülerinnen und Schüler nach draussen und lernen am realen Objekt, kann der Lernprozess nachweislich sehr wirksam sein.
Gibt es Fächer, die sich wenig oder gar nicht eignen für den Unterricht draussen?
Nein. Es gibt sicherlich Themen, die sich weniger eignen, aber grundsätzlich kann jedes Fach zumindest teilweise auch draussen unterrichtet werden. Aktuell ist es noch häufig so, dass Klassen im 3. Zyklus weniger rausgehen, weil es mehr unterschiedliche Fachlehrpersonen gibt, die nur Einzellektionen halten. Der Radius ist dadurch eingeschränkter. Für den 3. Zyklus ist die nahe Umgebung rund ums Schulhaus passend für den Unterricht im Freien. Zudem eignen sich im 3. Zyklus Projektwochen besonders für Draussenlernen.
Während bei den jüngeren Kindern noch die Umwelt- und Naturbildung im Fokus stehen, ist beim Draussenlernen mit Jugendlichen ein anderer Fokus gesucht. Wie kann das in die Unterrichtsgestaltung einfliessen?
Die natürlichen Veränderungen interessieren die Jugendlichen meist weniger. Im Zentrum stehen oft Fragen der eigenen Entwicklung und sie beschäftigen sich zunehmend im digitalen Raum. Der Unterricht im Freien kann digitale Pausen ermöglichen. Um die Jugendlichen für Themen der Natur und Umwelt ansprechen zu können, ist es hilfreich, einen Bezug zwischen ihnen und der Umwelt herzustellen: Was hat das Thema mit mir zu tun? Welchen Beitrag kann ich leisten? Für Jugendliche muss ein deutlicher Bezug zu ihren eigenen Leben erkennbar sein.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das Thema Mobilität: Ein gesellschaftlich zentrales Thema, das sich gerade in der Stadt Basel gut erforschen lässt. Um den Verkehr zu beobachten, kann man mit der Klasse nach draussen gehen, zählen und gemeinsam erforschen: Wie viele Velofahrer sehen wir? Wie viele Autos fahren an der Kreuzung vorbei? Wie viele Leute sitzen im Trämli, das gerade vorbeifährt? Im Hintergrund stehen dabei wesentliche Überlegungen: Wie gestaltet sich die Mobilität in unserer Stadt? Wie wollen wir, dass sich die Mobilität in der Stadt entwickelt? Was macht eine gute Mobilität aus? Dieses Beispiel zeigt eine ganz andere Form des Draussenlernens als mit den jüngeren Kindern im Wald, aber es ist genauso wertvoll. Es geht darum, eine Fragestellung zu finden, die eine Verbindung schafft zu den Themen der Jugendlichen. Schafft man es, sie über ihre eigenen Interessen abzuholen und mit relevanten Gesellschaftsfragen zu konfrontieren, kommen diese auch tatsächlich in Aktion. Dazu gehört auch ein zweiter Teil, der im Klassenzimmer stattfinden kann, bei dem man miteinander über die Beobachtungen und Resultate in Austausch kommt. Der Transfer zurück ins Schulzimmer ist auch ein zentrales Element von Draussenlernen. Es bietet sich also eine Kombination an: Ein Erlebnis draussen mit der aktiven Beteiligung der Jugendlichen und die anschliessende Reflexion darüber, was das mit der Welt zu tun hat, in der wir leben. Dann sind wir bereits mitten in der Bildung für nachhaltigen Entwicklung (BNE), die ja auch im Lehrplan 21 verankert ist.
Was für eine Entwicklung nehmen Sie betreffend Draussenlernen in der Schweiz wahr?
Seit der Corona-Pandemie hat Draussenlernen einen Schub erhalten, weil man gezwungen war, Alternativen zum Klassenzimmer zu finden. Viele Lehrpersonen haben durch diese neuen Möglichkeiten des Unterrichtens einen Impuls erhalten. Vielleicht trägt auch die zunehmende Nutzung digitaler Medien dazu bei, dass Lehrpersonen nach einer Ergänzung suchen. Wir spüren konkret eine grosse Nachfrage seitens der Studierenden, die sich in der Ausbildung für eine Spezialisierung Naturpädagogik entscheiden. Auch die Outdoor-Weiterbildungen sind sehr gefragt.
Selbstverständlich ist es viel einfacher, das Draussenlernen umzusetzen, wenn der Wald direkt vor der Tür liegt, aber die Stadt bietet auch sehr schöne Nischen. Entscheidend ist bei einem Ortswechsel, dass man den Lernort nicht nur als Kulisse, sondern auch als Lerninhalt begreift und nutzt.
Interview von Maren Stotz, Foto: zVg